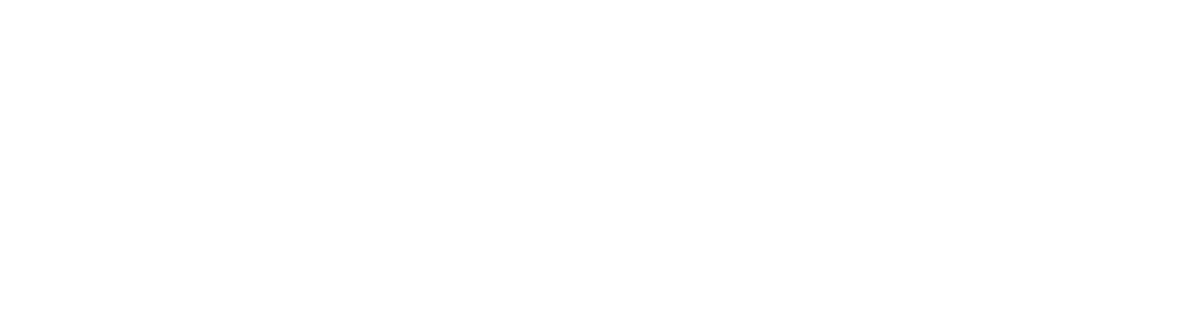Partner für IceCube-Gen2
Mehr als 430 Wissenschaftler:innen an 61 Forschungseinrichtungen aus 13 Ländern auf vier Kontinenten werden an Planung, Bau und Betrieb des IceCube-Gen2-Projekts beteiligt sein. Ein Großteil der Partner arbeitet bereits seit 1999 erfolgreich im IceCube-Projekt zusammen; einige haben sogar schon zu Vorgängerprojekten am Südpol beigetragen.
IceCube-Gen2 baut auf der großen Erfahrung des IceCube-Projekts auf, führt die bewährte Zusammenarbeit fort und baut sie im Hinblick auf die neuen Technologien und Forschungsprojekte weiter aus. Das zentrale Projektbüro für IceCube-Gen2 stellt wie auch schon für IceCube und das IceCube Upgrade die Universität von Wisconsin-Madison, USA. Sie ist auch verantwortlich für den laufenden Betrieb des Neutrino-Observatoriums am Südpol.
Weltweit übernehmen führende Partnerinstitutionen weitere wichtige Aufgaben. Beispielsweise wird DESY ein Drittel aller neuen digitalen optischen Sensoren für den Detektorausbau produzieren. Insgesamt sind allein in Europa 18 Forschungsgruppen Teil der Planung von IceCube-Gen2.

IceCube-Gen2 weltweit
- 13 Nationen
- 61 Institutionen
- mehr als 430 Forschende
- über 20 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit
Deutsche Beteiligung
Im internationalen IceCube-Team stellt Deutschland nach den USA das zweitstärkste Kontingent, mit etwa einem Viertel der beteiligten Wissenschaftler:innen. Die deutschen Institutionen sind auf allen Ebenen der IceCube-Kollaboration vertreten. Als größter europäischer Partner stellt DESY einen von zwei Koordinatoren von IceCube-Gen2. Weiterhin sind zehn deutsche Universitäten beteiligt, wobei das Karlsruher Institut für Technologie sowohl Universität als auch wie DESY Helmholtz-Zentrum ist.
Die Arbeitsgruppen in Deutschland leisten einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung von IceCube-Gen2. Für die vorbereitende Phase, das IceCube-Upgrade, wurde am Erlangen Centre for Astroparticle Physics das Konzept der neuen optischen Sensoren entwickelt. DESY ist verantwortlich für das Gesamtarbeitspaket optische Sensoren, das in einer Partnerschaft mit deutschen Universitätsgruppen unter Leitung der Universität Münster (mDOM) und Mainz (alternative Sensoren) umgesetzt wird. Grundlegende Beiträge zum Kalibrationskonzept des IceCube-Upgrades und IceCube-Gen2 kommen besonders von der RWTH Aachen und der TU München. Für die Entwicklung und den Bau der Oberflächen-Detektoren für die Erweiterung von IceCube ist das KIT Karlsruhe verantwortlich. Die TU Dortmund trägt wesentlich zur Entwicklung der Methoden der Künstlichen Intelligenz und des Machine Learnings bei.
Finanziert durch eine starke Gemeinschaft
Die deutsche Beteiligung an IceCube wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), die Helmholtz-Gemeinschaft, die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und die beteiligten Universitäten finanziert. Die Zusammenarbeit der Universitäten und der außeruniversitären Forschungseinrichtungen für das IceCube-Upgrade wird im Rahmen des BMBF-Programms ErUM-Pro organisiert.
Hinzu kommen Förderungen für die Exzellenzcluster „PRISMA+ - Precision Physics, Fundamental Interactions and Structure of Matter“ an der Universität Mainz, und „ORIGINS - Vom Ursprung des Universums bis zu den ersten Bausteinen des Lebens“ mit Beteiligung der TU München, für die Sonderforschungsbereiche SFB 876 „Datenanalyse unter Ressourcenbeschränkung“ an der TU Dortmund und SFB 1258 „Neutrinos and Dark Matter in Astro- and Particle Physics“ an der TU München. Gefördert mit einem Emmy-Noether-Stipendium der DFG und des Helmholtz W2-Programms wird Prof. Dr. Anna Nelles, Radio-Array-Gruppe an der FAU Erlangen-Nürnberg und mit einem ERC Starting Grant Dr. Frank Schröder, Wissenschaftler am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und Assistant Professor an der University of Delaware, USA.
IceCube in Deutschland
- 10 Universitäten
- 2 Helmholtz-Zentren
- KIT ist sowohl Universität als auch Helmholtz-Zentrum
Sprecher des deutschen IceCube-Konsortiums:
- Prof. Dr. Klaus Helbing
- Bergische Universität Wuppertal
Ko-Koordinator des internationalen IceCube-Gen2-Konsortiums:
- Prof. Dr. Marek Kowalski
- DESY & HU Berlin